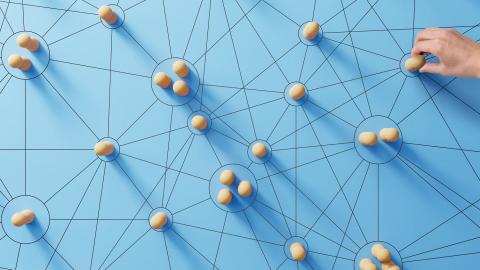Nachgefragt - Der MSB Podcast - Die Hauptschule

Die rund 150 Hauptschulen in NRW bieten Praxisnähe, individuelle Förderung, Berufsorientierung und sämtliche Schulabschlüsse der Sekundarstufe I. Darüber und wie Hauptschulen im Netzwerk noch mehr erreichen können, sprechen zwei Schulleiter und eine Referatsleiterin aus dem Schulministerium.
Podcast Folge 9 "Die Hauptschule"
Aufnahme vom 13. Januar 2025 im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen
Moderator: Ralf Dolgner, Referatsleiter 126, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit
Interviewpartnerin: Eva Maria Mikat, Referatsleiterin 513, Hauptschule
Interviewpartner: Thomas Czaja, Schulleiter Hauptschule Scharnhorst und Arndt Hilse, Schulleiter Karl-Simrock-Schule für Berufsorientierung Bonn
Dolgner: Neulich auf dem Pausenhof: „Machst du eigentlich Typ A oder schaffst du Typ B?“. Das sind Fachgespräche in der Schülerschaft an 154 Hauptschulen hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind damit direkt bei unserem Thema, nämlich die Hauptschule - eine zu oft unterschätzte Schulform, die aber unter anderem Praxisorientierung, individuelle Förderung, Berufsorientierung, soziale Kompetenzen und eben Typ A, Typ B auch Schulabschlüsse bietet. Über diese positiven Aspekte und wie Hauptschulen im Netzwerk noch mehr erreichen, darüber wollen wir heute in Nachgefragt, der MSB -Podcast sprechen. Mein Name ist Ralf Dolgner und ich bin Referatsleiter für das Amtsblatt, die BASS sowie für die Öffentlichkeitsarbeit hier im Schulministerium von Nordrhein -Westfalen. Ich begrüße zu unserem Thema Eva Maria Mikat, sie ist Leiterin des Referats 513. Dort geht es um Hauptschule, Realschule, Europaschule, zentrale Prüfung, sowie Schulentwicklungskonferenz. Hallo.
Mikat: Hallo, guten Tag.
Dolgner: Zu Gast sind zudem zwei Schulleiter, Herr Thomas Czaja von der Hauptschule Scharnhorst in Dortmund.
Czaja: Ja, guten Morgen Herr Dolgner. Ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung.
Dolgner: Und aus Bonn dabei ist Herr Arndt Hilse, Schulleiter der Karl-Simrock-Schule für Berufsorientierung, eine Ganztagshauptschule der Stadt Bonn.
Hilse: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
Dolgner: Frau Mikat, am 25. September 2024 fand der erste Hauptschultag unseres Landes in Essen statt. Zu Gast waren sämtliche Schulleitungen und Schulaufsichten der Schulform Hauptschule. Und Frau Ministerin Feller konnte sich während des ganzen Tages einen guten Eindruck über die wertvolle Arbeit der Hauptschulen machen sowie in verschiedenen Formaten mit den Schulleitungen auch in den Austausch gehen.
Was waren Ihre persönlich wichtigsten Eindrücke vom Hauptschultag?
Mikat: Ja, Ziele des Tages waren es, die Wertschätzung der Arbeit in den Hauptschulen zu zeigen, aber auch den Stellenwert der Hauptschulen in der Bildungslandschaft herauszustellen und besonders die Möglichkeiten zu schaffen, sich untereinander zu vernetzen. Geplant war, dem Tag ein offenes Format zu verleihen, in dem unterschiedliche Bausteine unter dem Titel „Hashtag Hauptsache Hauptschule“ miteinander verbunden wurden und die Schulleitungen viele gute Möglichkeiten bekamen, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihre Vernetzung untereinander weiter auszugestalten. Dafür hatten wir einen moderierten Austausch mit der Ministerin Feller nach dem Motto „Auf ein Wort mit Frau Feller“. Wir haben aber auch zwölf Workshops angeboten. Mit 17 Ausstellungen haben wir auf dem Markt der Möglichkeiten gepunktet. Es hat stattgefunden eine Podiumsdiskussion mit Frau Ministerin Feller, dem Präsidenten der Handwerkskammer Dortmund, Bertolt Schröder, dem Bürgermeister der Stadt Dülmen, Herrn Carsten Höfekamp, und VertreterInnen aus den Schulgemeinschaften verschiedener Hauptschulen.
Dolgner: Also ein interessantes, buntes, kompaktes Paket. Herr Hilse, Sie sind Schulleiter der Hauptschule Karl Simrock in Bonn und waren ebenfalls in Essen vor Ort. Haben Sie das auch so empfunden oder was haben Sie später den Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Schule vom Hauptschultag berichten können?
Hilse: Genau so, Herr Dolgner. Mich hat total beeindruckt, wie klar sich unsere Schulministerin zur Wichtigkeit unserer Hauptschulform Hauptschule bekennt. Und mich hat beeindruckt, was die anderen Schulen gemacht haben. Die Bandbreite von dem, was man dort sehen konnte, das war beeindruckend.
Dolgner: In der Öffentlichkeit hat es die Hauptschule ja dennoch irgendwie schwer. Bei der Schulformwahl der weiterführenden Schulen meiden Eltern häufig die Hauptschule. Aber warum kann die Hauptschule häufig der bessere Ort als beispielsweise die Realschule oder die Gesamtschule für das eigene Kind sein?
Hilse: Die Hauptschule ist eine besondere Schulform. Wir berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und bieten praktische Fähigkeiten einfach, weil wir die Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule vorbereiten wollen. Das ist tiefes Anliegen unserer Schulform. Und was viele außerhalb dieser Schule und dieser Schulform nicht wissen, wir vergeben am Ende der Schulzeit alle Schulabschlüsse, die man am Ende der Sekundarstufe 1 an anderen Schulen und Schulformen auch erreichen kann. Am Ende der 9 vergeben wir den ersten Schulabschluss. Das ist der ehemalige Hauptschulabschluss 9. Am Ende von Klasse 10 vergeben wir den Schulabschluss 10 Typ A, der mittlerweile erweiterter erster Schulabschluss heißt, der alte Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Und wir vergeben die mittlere Reife und bei besonders stimmiger Notenlage, bei mindestens befriedigenden Leistungen in allen Fächern auch die mittlere Reife mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe nach Klasse 10. Und das möchte ich hier noch deutlich sagen, was viele nicht wissen. Auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen nach Klasse 10 und dort einen Meister anzuschließen oder aber eine bestimmte Anzahl an Berufsjahren nachzuweisen, führt dazu, dass junge Leute auch ohne Abitur nachher studieren können.
Dolgner: Herr Hilse, Ihre Schule trägt offiziell den Namen „Karl -Simrock - Schule für Berufsorientierung“. Ihre Schule trägt zudem das Siegel „Starke Schule, Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ und wurde 2023 als eine von zwei Schulen in Nordrhein -Westfalen als Botschafter-Schule für Berufsorientierung ausgezeichnet. Erklären Sie uns doch bitte kurz, was sich hinter dieser ungewöhnlichen Namensgebung und ihrem Konzept verbirgt.
Hilse: Ja, wir wollten, Herr Dolgner, dass man direkt schon am Schuleingang sieht, warum wir das tun. Wir wollen junge Menschen vorbereiten auf die Zeit nach der Schule und wir wissen, dass nach der Schule der Beruf kommt. Und wir haben seit 2009 die Namensergänzung im Schulnamen „Schule für Berufsorientierung“. Die Ergänzung steht für ein durchgängiges und modellhaftes Unterrichtskonzept, das wir mit dem Kollegium entwickelt haben. Wir haben geguckt, was sind unsere besonderen Stärken? Was sind auch die Ressourcen, die wir haben als Schule? Und dann waren wir froh, dass unser Unterrichtskonzept als Schulentwicklungsvorhaben vom Schulministerium genehmigt worden ist und dauerhaft auch inzwischen gestattet ist. Also wir werden lebenslänglich Schule für Berufsorientierung sein.
Dolgner: Was heißt das dann vor Ort direkt in der Praxis?
Hilse: Also das heißt vor Ort in der Praxis beispielsweise, dass bei uns schon die Kleinsten in Klasse 5 Praktika machen. Denn Berufsorientierung machen viele schon im Kindergarten und auch an der Grundschule. Da geht man zum Bäcker, zur Polizei, zur Feuerwehr und wir wollten, dass das in Klasse 5 nahtlos anschließt. Wir haben im Jahrgang 8 ein Projekt eingeführt, das nennt sich „Praxistag.“ Wir haben Rückenwind von einer Stiftung und alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 bekommen an jedem Freitag während des Schuljahres Besuch von Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern. Und meine Lehrerinnen und Lehrer begleiten diese Handwerksmeister, die dann mit Schülerinnen und Schülern Dinge machen, die man im Berufsalltag braucht. Im aktuellen Schuljahr haben wir einen Schreinermeister, zwei Malermeister, zwei Köche, einen Dachdecker und einen Gärtner. Und Sie können sich vorstellen, unsere Schule ist, was Renovierung angeht, wirklich auf Stand, da die Jugendlichen eine ganze Menge selber machen und meine Meisterinnen und Meister und auch meine Lehrerinnen und Lehrer zeigen, wie es geht.
Dolgner: Schlägt sich das dann auch in der Quote der Schülerinnen und Schüler nieder, die nach Beendigung ihrer Schulzeit womöglich direkt eine Ausbildung beginnen?
Hilse: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben mittlerweile eine Übergangsquote in Ausbildung nach Klasse 10 nach dem Schulabschluss, die liegt stabil zwischen 33 und 40 Prozent. Obwohl, meine Schule liegt in Bonn, das ist ein Ort, an dem ganz häufig auch höher qualifizierte Ausbildungsplätze angeboten werden. Aber wir sind stolz darauf, dass wir diese Quote deutlich gesteigert haben.
Dolgner: Herr Czaja, von Bonn nach Dortmund, einmal quer durch NRW. Sie sind Schulleiter der Hauptschule Scharnhorst in Dortmund. Welche Schwerpunkte setzen Sie im Rahmen von Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung an Ihrer Schule?
Czaja: Unter der Berücksichtigung der Standard-Elemente von KAOA (Kein Abschluss ohne Anschluss) setzen wir in der Berufswahl besonders auf Praktika. Das heißt Schülerbetriebspraktika, Schnupperpraktikum, Langzeitpraktikum, Kompetenzchecks und das Bewerbungstraining. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Dortmund arbeiten wir mit Betrieben aus der näheren Umgebung zusammen, generieren Praktikums- und Ausbildungsplätze und organisieren Betriebsbesichtigungen. Besonders stolz sind wir aber auf ein Projekt, nämlich den Schulgarten, wo wir eine Holzhütte gebaut haben aus verschiedenen Gewerken, wo zum Beispiel der Elektriker vor Ort da ist, wo die Schülerinnen und Schüler an Praktikumstagen selber das Gewerk kennenlernen können, wo der Dachdecker vor Ort ist, wo die Schülerinnen und Schüler eine Dachpfanne in die Hand nehmen können und das Dach selber decken können und wo das Fundament aus Beton von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet wird. Da ist manchmal ein Bagger vor Ort, da sind welche an der Schüppe, da kommen welche mit dem Kran an und müssen was heben und die Schülerinnen und Schüler dürfen alles ausprobieren.
Dolgner: Perfekt. Ich nehme an, Ihre Abgangszahlen in Richtung Ausbildung ist bei Ihren Schülerinnen und Schülern ähnlich wie hier in Bonn?
Czaja: Ja, wir haben 2024 32 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler in Ausbildung gebracht und die restlichen Schülerinnen und Schüler sind zum Großteil weiter zur Schule gegangen, einige davon an die Gesamtschule oder an das Gymnasium. Und die Rückmeldung ist oft so, dass sie nach dem ersten Halbjahr von der Gesamtschule zu uns kommen und sagen, wir haben das beste Zeugnis. Also das spricht ja auch nicht gegen die Hauptschulen.
Dolgner: Perfekt. Alles, was wir jetzt gehört haben von Herrn Czaja oder auch von Herrn Hilse, da geht es ja um das klassische Handwerk quasi. Aber Schule muss ja auch zukunftsfähig sein und das Thema „Digital“ ist ganz oben auf der Agenda. Herr Czaja, wie sieht das bei Ihnen an Ihrer Schule damit aus?
Czaja: Ja, die Schule hat 2023 die MINT-Zertifizierung gekriegt und ist eine der wenigen Hauptschulen, die das überhaupt erreicht haben. Regelmäßig führen wir die sogenannten „Hackdays“ bei uns durch. Da kommen Firmen in die Schule, wie zum Beispiel Wilo Pumpen in Dortmund - ein großer Arbeitgeber in Dortmund, der sich da angeschlossen hat, um die technischen und kreativen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler zu nutzen, um Alltagsprobleme zu lösen, die sich im Schulalltag ergeben, zum Beispiel Chipkarten für Türöffner oder die digitale Anzeige für die Mensa oder auch der digitale Vertretungsplan. An unserer Schule können die Schülerinnen und Schüler einen Internetführerschein machen und betreuen die Homepage zum Großteil. Das bedingt aber auch, dass ich natürlich Lehrerinnen und Lehrer haben muss, die in diesem Bereich arbeiten können. Und ich habe zum Glück 20 Naturwissenschaftler bei mir an der Schule, was ein großes Plus ist, um das überhaupt zu erreichen.
Dolgner: Herr Hilse, Digitalisierung hat auch in Ihrem Schulalltag Einzug gehalten. Wie stellen Sie Ihre Schule denn digital auf?
Hilse: Bei uns ist es so, wir sind völlig raus aus der Kreidezeit. Wir haben in allen Räumen inzwischen digitale Displays. Die Lehrerinnen und Lehrer haben alle Dienst-iPads, die man verbinden kann mit den Displays. Also Unterrichtsvorbereitung hat sich völlig geändert. Wir sind ausgestattet mit Glasfaser in allen Räumen. Es geht rasend schnell. Und schon die Kleinsten bei uns erwerben in Klasse 5 den PC-Führerschein, damit sie auch gut mithalten können bei dem, was wir so haben. Und Stichwort Berufsorientierung und Digitalisierung: auch da hat sich die Berufswelt verändert. Der Dreher hat früher an der Drehbank gedreht und der Zerspanungsmechaniker macht das heute an CNC-Werkzeugen. Die haben wir auch, denn wenn wir vorbereiten wollen und Lust machen wollen auf Ausbildung, dann muss man auch das Equipment vor Ort haben. Und man braucht auch Lehrerinnen und Lehrer, die das können.
Dolgner: Herr Czaja, neben der fachlichen und digitalen Bildung, haben wir gerade gehört, spielt in unseren Schulen natürlich auch Erziehung und Werteerziehung eine große Rolle. Wie schaffen Sie es, ein gutes Schulklima und eine lernförderliche Atmosphäre herzustellen?
Czaja: Ja, erstmal gibt es bei uns an der Schule soziales Lernen. Und das wird durch das Trainingsraumkonzept und die Streitschlichtung gefördert. Zudem gibt es zahlreiche AGs und Gruppen, Schulgarten, Schülerzeitung, Reiten, Pferdepflege, Tischtennis, Fußball und vor allen Dingen viele Angebote in Sachen Berufsvorbereitung. Doch das wirklich Wichtigste ist, ein klares Regelwerk zu haben, das für Schülerinnen und Schüler gilt, aber auch für meine Lehrerinnen und Lehrer. Denn wir sind die Vorbilder und wir müssen auch dieses klare Regelwerk durchsetzen. Und unsere Schülerinnen und Schüler, aus der Erfahrung heraus, verlangen nach Regeln, die sie zu Hause nicht mehr haben.
Dolgner: Wenn man die Zeitungen aufschlägt, Radio einschaltet oder auch das Fernsehprogramm, die Nachrichten sich dort ansieht: Krisen und Kriege prägen unsere weltpolitische Lage zurzeit. In unserer Gesellschaft zeigen sich zuweilen rechtsextreme Tendenzen. Und wir sehen mit Sorge auch, dass manche Mitbürgerinnen und Mitbürger den Bezug zur Demokratie zu verlieren drohen. Diese Themen kommen natürlich auch in den Klassenzimmern und auf den Schulhöfen an. Die Vermittlung von Demokratiekompetenz ist daher einer der bildungspolitischen Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Wie schaffen Sie es an Ihrer Schule, eine partizipative Schulkultur zu fördern und demokratische Werte erlebbar zu machen?
Czaja: Ja, seit Mai 2023 sind wir Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Aber wir haben ja im Vorfeld schon viele Projekte zu diesem Thema gemacht, Antidiskriminierung. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule eigenständig für den Beitritt in das Netzwerk geworben, die Wahlen organisiert und die Stimmen ausgezählt. Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts geht es in Kleingruppen aus der siebten und achten Klasse für zwei Schulstunden pro Woche in die Scharnhorster Jugendfreizeitstätte, das Zentrum. Dort gestalten sie Aufenthaltsräume und den Gartenbereich unter Einbindung von Themenarbeit wie Vielfalt, Toleranz und Selbstwirksamkeit. Dabei wird das Fachwissen aus dem Schulalltag mit einbezogen. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erleben, indem sie einen Treffpunkt in unmittelbarer Nähe des Zuhauses aktiv mitgestalten und erkennen, dass Engagement sich lohnt und Nachhaltigkeit sich frei nach dem Motto von Kids und Jugendlichen für Kids und Jugendliche ergibt.
Dolgner: Sehr schön. Herr Hilse, die Bundestagswahl steht ja quasi direkt vor der Tür jetzt Ende Februar. Welche Schwerpunkte setzen Sie im Rahmen der Demokratieförderung an Ihrer Schule?
Hilse: Ja, wir haben das große Glück, dass die Klassen Displays und das rasend schnelle Glasfaser haben und alle Klassen gucken regelmäßig gemeinsam Nachrichten, weil das in den Familien zu Hause oft nicht mehr passiert. Dazu haben wir Lizenzen für Wochenzeitungen, um Jugendliche auch mit aktuellen Nachrichten zu versorgen, die in vielen Klassen auch begeistert gelesen werden. Diese Wochenzeitungen haben Aufgaben, die bearbeiten die Lehrerinnen und Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern. Das machen wir ganzjährig. Jetzt zur Bundestagswahl beteiligen wir uns wieder am Projekt Juniorwahl. Das haben wir schon mehrfach gemacht mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Und interessant ist, dass die Ergebnisse der Juniorwahl in unserer Schule ziemlich nah bei denen sind, wie der Wahlkreis vor Ort gewählt hat. Interessanterweise. Plus wir machen Demokratiebildung, weil wir wöchentlichen Klassenrat in allen Klassen haben. Wir haben eine aktive SV. Und ich glaube, das zeichnet uns auch noch aus, wir machen einmal monatlich eine große Schulversammlung in der Sporthalle. Das haben wir ein bisschen adaptiert aus Amerika. Dort gibt es solche Veranstaltungen, die nennt man dort Assembly. Und bei diesen Versammlungen besprechen wir alles, was wichtig ist für die Schule, was für das Schulleben wichtig ist. Wir begrüßen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verabschieden diese und feiern auch zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben.
Dolgner: Herr Hilse, Herr Czaja, auf dem Hauptschultag haben wir eingangs ja gehört, spielten die Themen Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Schulen, aber auch mit externen Partnern eine große Rolle. Warum ist Vernetzung aus Ihrer Sicht so wichtig?
Hilse: Ja, weil Schulen voneinander lernen können. Es gibt bewährte Konzepte, die übernommen werden können. Es gibt innovative Unterrichtsmethoden, die ausgetauscht werden können. Und das alles führt zu einer erfolgreichen Schulentwicklungsstrategie.
Czaja: Die Lehrkräfte können voneinander profitieren. Es gibt eine Arbeitserleichterung. Es muss nicht alles von jeder Schule neu verschriftlicht werden, sondern man tauscht sich eben aus. Viele Schulen stehen vor den ähnlichen Herausforderungen: Digitalisierung, Sprachförderung. Gemeinsam lassen sich Lösungen schneller finden und eventuell auch gemeinsam umsetzen.
Hilse: Ja, und ich finde, man braucht auch Vernetzung vor Ort. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das finde ich gilt auch für Schule. Da wirken alle mit vor Ort, die um die Schule drumherum sind. Und gleichzeitig, wenn man vernetzt ist, wird Schule sichtbar. Schule sichtbar vor Ort, Schule sichtbar in der Region. Das stärkt die Bedeutung. Und gleichzeitig erhöht das auch die Chancen der Schülerinnen und Schüler, gerade wenn es darum geht, eine nachschulische Perspektive, die Ausbildung oder ähnliches anzubahnen.
Dolgner: Herr Czaja, Herr Hilse, ich habe Sie als Schulleiter hier in diesem Gespräch mit Herz und Seele jetzt kennengelernt. Was motiviert Sie persönlich in Ihrer Arbeit als Schulleiter?
Czaja: Ja, mich motiviert, dass ich Kindern und Jugendlichen eine Perspektive geben kann, die also zu Hause nicht diese Unterstützung haben, die vielleicht unsere eigenen Kinder zu Hause genießen können. Das ist erstmal der Hauptgrund, warum ich überhaupt Schulleiter geworden bin. Und damit ich diese Schule so gestalten kann, um diese Ziele zu erreichen.
Dolgner: Und bei Ihnen?
Hilse: Hauptschulen waren wiederholt die Schulform, die als erste unter den Schulformen aufkommende Probleme lösen musste. Wir waren die ersten, die den Ganztag eingeführt haben. Wir mussten Konzepte entwickeln, gucken, wie das gut geht. Wir waren Pioniere in den Bereichen Inklusion, Integration und vor allen Dingen auch in unserer großen Stärke Berufsorientierung. Wir mussten neu denken und Neues entwickeln. Und das ist etwas, was antreibt und unheimlich Kreativität auch ermöglicht.
Czaja: Und was mir besonders Spaß macht, an der Hauptschule zu arbeiten ist, ich bin Teamplayer und ich brauche immer ein gutes Team um mich herum. Alleine bin ich gar nichts. Und wenn ich ein gutes Team habe, dann kann das erfolgreich sein. Das ist in jeder Sportart so und das spiegelt sich im Berufsleben aus meiner Sicht immer wieder. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, dieses Team zusammenzustellen und damit Erfolg zu haben.
Dolgner: Perfekt. Frau Mikat, es hört sich doch alles sehr danach an, dass der Hauptschultag keine Eintagsfliege bleiben soll. Welche weiteren Schritte sind da geplant?
Mikat: Mit dem laufenden Schuljahr werden 46 Hauptschulen in das Startchancenprogramm aufgenommen. Zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 werden weitere Hauptschulen folgen. Die themenbezogene Vernetzungsarbeit im Rahmen des Programms dient dem Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Das Personalbudget bietet zudem die Möglichkeit, die multiprofessionellen Teams an den Schulen auszubauen. Dies unterstützt die Weiterentwicklung von Schulprojekten und die Stärkung des Schulprofils. Seit Beginn der Legislaturperiode findet im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungsreihe „Ministerin im Dialog“ sowie im Rahmen von zahlreichen Schulbesuchen an Hauptschulen ein Austausch der Hausleitung mit Mitgliedern der Schulgemeinschaft statt. Auf diese Weise wird die Sichtbarkeit dieser Schulform erhöht, die uns besonders wichtig ist. Auf verschiedenen Ebenen werden in Zusammenarbeit mit der oberen und unteren Schulaufsicht die Kooperation und Vernetzung der Hauptschulen weiter ausgebaut. Regelmäßig finden Austausche des MSB, Ministeriums für Schule und Bildung, mit der oberen und der unteren Schulaufsicht statt. Diese dienen auch dazu, die Netzwerkbildung vor Ort zu unterstützen. Also ein bunter Strauß von nächsten weiteren Schritten.
Dolgner: Frau Mikat, vielen Dank für diese, ja quasi am Ende, für diese Zusammenfassung, wie es denn weitergeht. Und ich nehme mal an, die Hauptschule bleibt eine wichtige, tragende Säule des mittlerweile mehrgliedrigen Schulsystems. Und Herr Czaja, Herr Hilse, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Mittun hier und für Ihre Schulen alles Gute, für Ihre Schulleitungsaufgaben weiterhin alles Gute für 2025, 2026 … Vielen Dank.
Hilse und Czaja: Dankeschön.
Mikat: Danke auch.